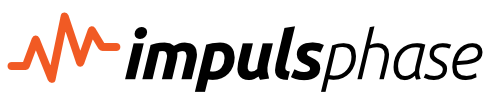Was ist Red Teaming? Einfach erklärt!
Red Teaming ist eine umfassende Sicherheitssimulation, bei der ein eingespieltes Red Team die Perspektive realer Angreifer annimmt, um ein Unternehmen, sein Netzwerk und seine Systeme gezielt unter Druck zu setzen. Statt theoretische Schwachstellenanalysen zu liefern, wird in einem lebensechten Szenario gehandelt: Schwachstellen werden ausgenutzt, Zugänge werden erschlichen, Daten werden exfiltriert – allerdings kontrolliert, dokumentiert und ohne tatsächlichen Schaden zu hinterlassen. Die Organisation erhält dadurch ein realistisches Bild, welche Bedrohungen für sie bestehen, welche Sicherheitsmaßnahmen greifen und wo Defizite liegen.
Der Ansatz unterscheidet sich stark von klassischen Penetrationstests. Während Pentests meist vordefinierte Zeitfenster und klar abgesteckte Ziele haben, arbeitet ein Red Team über Wochen oder Monate verdeckt. Es nutzt eine breite Palette an Techniken, von Social Engineering über Phishing-Kampagnen bis hin zu ausgefeilter Infrastruktur-Kommunikation. Durch diese simulierte Übung entsteht eine tiefgehende Simulation, die nicht nur technische, sondern auch organisatorische und menschliche Verteidigungslinien prüft, um die aktuelle Sicherheitslage eines Unternehmens realitätsnah abzubilden.
Historischer Ursprung des Begriffs “Red Teaming”
Der Ausdruck stammt aus dem militärischen Umfeld. Bereits während des Kalten Krieges testeten Streitkräfte ihre Verteidigung, indem sie ein „rotes“ Team mit der Simulation gegnerischer Angriffe beauftragten. In der IT-Sicherheit wurde der Gedanke übernommen, um kritische Systeme unter realitätsnaher Belastung zu testen.
So konnten Generäle Schlachtpläne verfeinern, Truppenbewegungen üben und funkgestützte Kommunikation auf Schwachstellen prüfen, ohne echte Gefechte riskieren zu müssen. Das Konzept faszinierte später Sicherheitsexperten, denn komplexe Netze ähneln Schlachtfeldern: unübersichtlich, dynamisch, voller Überraschungen. Ein künstlicher Gegner offenbart dabei Details, die herkömmliche Prüfungen übersehen und dadurch gezielte Gegenmaßnahmen schneller entwickeln lassen.
Zielgerichtete Simulation realer Angriffe
Im Zentrum steht ein klares Ziel: Das Red Team soll aufzeigen, wie weit ein motivierter Angreifer in die Infrastruktur eindringen kann. Jede Vorgehensweise orientiert sich an glaubhaften Taktiken. So entsteht ein praxisnahes Bild der Risiken, das weit über simple Checklisten hinausgeht und verschiedenste Angriffsvektoren berücksichtigt.
Die Route zum Angriffsziel wird nicht fest vorgegeben, sondern dynamisch gewählt; dadurch bleibt das Szenario offen für unvorhergesehene Wendungen, wie sie echte Angreifer ausnutzen. Neben rein technischen Wegen fließen physische Zutrittsversuche, Social-Engineering-Dialoge sowie gezielte Desinformation in das Drehbuch ein, sodass Verteidigungsschichten umfassend beleuchtet und Reaktionen messbar werden für alle Beteiligten.
Abgrenzung zu klassischen Pentests
Pentests prüfen definierte Schwachstellen in begrenzter Zeit. Red Teaming hingegen deckt den gesamten Prozess eines Angriffs ab: Aufklärung, Initialzugriff, Persistenz, laterale Bewegung, Privilegienausweitung und finale Erreichung des Missionsziels. Pentests beantworten die Frage „Lässt sich Sicherheitslücke X ausnutzen?“, das Red Team die Frage „Kann ein Akteur die Mission unter realen Bedingungen erfüllen?“. Auf diesem Weg werden nicht nur einzelne Sicherheitslücken, sondern die Gesamtheit der Verteidigung bewertet.
Dabei bleibt der Scope oft eng, zum Beispiel auf einen Webservice oder ein geschlossenes VLAN beschränkt, sodass Angriffe außerhalb des vereinbarten Rahmens unbeachtet bleiben. Red Teaming erweitert diese Grenzen bewusst, kombiniert scheinbar getrennte Komponenten, kettet Schwachstellen zusammen und testet auch Prozesse wie Alarmierung, Eskalation und forensische Sicherung in Live-Umgebungen.
Zusammenspiel mit dem Blue Team
Ein Blue Team verantwortet Verteidigung und Monitoring. Während ein Red Team eine verdeckte Kampagne fährt, reagiert das Blue Team mit Erkennungs- und Abwehrmaßnahmen. Treffen beide aufeinander, entsteht ein dynamisches Katz-und-Maus-Spiel, aus dem sich wertvolle Erkenntnisse zum Reifegrad der Sicherheitsmaßnahmen gewinnen lassen.
Log-Analysten im Security Operations Center verfeinern währenddessen ihre Dashboards, korrelieren Warnungen, stimmen sich mit Incident-Handlern ab und dokumentieren jeden Schritt. Jeder Fehlalarm, jede verzögerte Reaktion und jede unerwartete Detektion fließt in Lessons Learned ein. So entsteht eine Lernschleife, die Systeme härtet und Prozesse sukzessiv beschleunigt, sowie das Sicherheitsteam enger verzahnt.
Phasen eines Red-Teaming-Einsatzes
Ein geordneter Ablauf schafft Transparenz für alle Beteiligten. Die Initialphase beginnt mit der Festlegung des Ziels. Soll der Zugriff auf sensible Daten erlangt oder die Verfügbarkeit einer kritischen Anwendung beeinträchtigt werden? Anschließend startet die Reconnaissance: öffentlich verfügbare Informationen über Infrastruktur, Mitarbeiter und historische Sicherheitsvorfälle werden gesammelt.
Darauf folgt der Angriffseintritt. Hier kommen Phishing-E-Mails, Wasserloch-Websites, USB-Drops oder Schwachstellen in VPN-Gateways zum Einsatz. Gelingt der erste Zugang, verlegt sich die Aktivität auf das interne Netzwerk. Laterale Bewegung, das Umgehen von Segmentierungen und die Suche nach ungeschützten Systemen bilden das nächste Kapitel. Zum Ende hin demonstriert das Red Team den Missionserfolg, dokumentiert jede Aktion und übergibt sämtliche Erkenntnisse an die Verteidiger. Dieser Prozess liefert der Organisation eine vollständige Storyline vom ersten Paket bis zur finalen Daten-Exfiltration.
Die gesamte Durchführung wird als simulierte Übung verstanden. Sie zeigt, wie schnell echte Hacker unentdeckt bleiben könnten und welche Angriffe aktuell erfolgversprechend sind. Gleichzeitig dient sie dazu, Incident-Response-Pläne in Echtzeit zu testen und Verantwortlichkeiten zu schärfen.
Taktiken, Techniken und Verfahren nachbilden
Authentizität hängt davon ab, wie präzise gängige Angriffs-TTPs (Tactics, Techniques, Procedures) nachgestellt werden. Frameworks wie MITRE ATT&CK strukturieren diese Methoden und helfen, nichts zu übersehen. Das Red Team führt Command-and-Control-Verbindungen in verschlüsselten Kanälen aus, tarnt Traffic als legitime Cloud-Kommunikation und nutzt Living-off-the-Land-Binaries, um auf Zielrechnern keine verdächtigen Dateien zu hinterlassen.
Auch Engineering auf Netzwerkebene kommt zum Tragen: DNS-Tunneling, Domain-Fronting oder das Umleiten von Verkehr über gehackte IoT-Geräte ermöglichen stabile Kanäle. Mit solchen Tricks verdeutlichen die Hacker, dass moderne Cyberangriffe nicht immer auf Malware angewiesen sind. Durch dieses Repertoire erhalten Verteidiger die Möglichkeit, ihre Detektionsregeln gegen echte, aktuell beobachtete Cyberangriffe zu testen und ihre Fähigkeiten in der Cybersicherheit zu steigern. Red-Teaming-Spezialisten analysieren zudem Zeitverhalten von Sicherheitslösungen: Wie rasch blockt ein Proxy den ersten Callback, wann greift das EDR ein, welche Alarme landen tatsächlich im SIEM?
Parallel wird die interne Kommunikation sondiert. Wer informiert wen, wenn verdächtige Logs auftauchen? An dieser Stelle zeigt sich, ob Playbooks praktikabel sind oder Theorie bleiben. Ergänzend kommen Honeypots zum Einsatz, um Nebelkerzen zu werfen und Abwehrreaktionen umzuleiten. So entsteht ein lebendiger Lernraum für das gesamte Sicherheitsteam. Fehler werden ohne Konsequenzen reflektiert und anschließend unmittelbar verbessert.
Werkzeuge und Infrastruktur für realistische Simulationen
Ein glaubwürdiges Szenario verlangt nach ausgefeilter Infrastruktur. Command-Server laufen oft verteilt auf Cloud-Instanzen, die täglich neu bereitgestellt werden, um Blocklisten zu entgehen. Automatisierte Sandbox-Erkennung wird durch individuell gebaute Malware-Loader umgangen. Für das Testen von physischen Zugangskontrollen hält das Team Lock-Picking-Sets, RFID-Cloner und Drohnen bereit.
Open-Source-Anwendungen wie Cobalt-Strike-Forks, Mythic oder Sliver spielen mit, doch werden sie meist angepasst, um bekannte Signaturen zu verändern. Zusätzlich entstehen Eigenentwicklungen, die genau auf die Zielumgebung zugeschnitten sind. Kontrollierte Traffic-Begrenzung, Tarnung durch Content Delivery Networks und die Nutzung von Container-Orchestrierung gehören ebenfalls dazu, um behelfsmäßig kompromittierte Rechner schnell umzusiedeln und Spuren zu verwischen.
Darüber hinaus betreibt das Red Team eigene Zertifikatsstellen, signiert binäre Payloads und führt Stresstests gegen E-Mail-Gateways aus, um zu prüfen, welche Filtermechanismen wirklich greifen und welche lediglich vermeintliche Sicherheit vermitteln, während Systeme unter Druck stehen.
Menschliche Faktoren: Social Engineering und Awareness
Technik allein schützt kaum, wenn Mitarbeiter auf eine überzeugende Phishing-E-Mail klicken. Darum bezieht Red Teaming systematisch menschliche Schwachstellen ein. Gefälschte Bewerbungsunterlagen mit präparierten Makros, Chat-Nachrichten über angebliche Paketlieferungen oder Telefonanrufe, die vorgeben, aus der IT-Abteilung zu stammen, gehören zum Repertoire.
Jede Kampagne klärt vorab juristische Fragen und setzt klare Grenzen, damit keine reale Gefährdung entsteht. Anschließend wertet das Team aus, wie viele User reagiert haben, welche Credentials preisgegeben wurden und wie schnell das Incident-Response-Team einschreiten konnte. Auf dieser Basis lassen sich Awareness-Programme verbessern und Maßnahmen zum Schutz vor Social-Engineering schärfen.
Durch regelmäßige, simulierte Angriffe festigt sich eine Kultur, in der alle Mitarbeitenden Sicherheit als fortlaufenden Prozess verstehen. Besonders effektiv erweist sich das „Assumed Breach“-Modell: Die Angreifer starten mit einem erbeuteten Domänenkonto und arbeiten sich weiter vor, um realistische Eskalation zu demonstrieren. Gleichzeitig stellt ein begleitender Coach sicher, dass betroffene Personen Feedback erhalten, Lerninhalte reflektieren und zukünftig mit mehr Selbstvertrauen verdächtige Hinweise melden – schnell proaktiv und ohne Zögern.
Messen, Auswerten und kontinuierliche Verbesserung
Ohne gründliche Auswertung wäre das Ganze nur ein Spiel. Darum hält das Red Team jede Aktion detailliert fest: Zeitstempel, verwendete Techniken, Zugriffspfade, entnommene Daten. Diese Chronik bildet die Grundlage für Debriefings. Während der Hot-Wash findet direkt nach Kampagnenende ein Austausch mit den Verteidigern statt. Dabei werden Detektionslücken, Stärken der Sicherheitsmaßnahmen und überraschende Ergebnisse diskutiert.
Ein ergänzender Blick auf organisierte Verteidiger lohnt sich: Ein dediziertes Sicherheitsteam begleitet die gesamte Übung als stiller Beobachter, sammelt Log-Daten und erstellt eine Zeitleiste aller Angriffsszenarien. Parallel führt ein zweites Sicherheitsteam kurze Penetrationstests durch, um zu testen, ob frisch gepatchte Dienste erneut angreifbar sind. Auf diese Weise erhält das Unternehmen eine doppelte Sicht – einmal durch Red Teaming und einmal durch punktuelle Prüfungen – was die Wirksamkeit der Maßnahmen transparent macht. Für viele Unternehmen zeigt sich so klar, welche Prozesse vor dem nächsten Audit angepasst werden sollten.
Langfristig fließen die Erkenntnisse in neue Use-Cases für SIEM-Systeme, in Härtungsleitfäden für Endpunkte und in aktualisierte Prozesse der Incident-Response. Wiederholtes Red Teaming – gern in jährlichen Zyklen – überprüft, ob Maßnahmen greifen und ob neue Bedrohungen angemessen adressiert werden. So entsteht ein Regelkreis, der die Sicherheit sukzessive steigert und greifbare Vorteile gegenüber reaktiven Prüfverfahren liefert.
Red Teaming im Zusammenspiel mit Blue und Purple Teams
Ein isoliertes Red Team erzielt nur begrenzte Wirkung. Erst das Zusammenspiel mit den Verteidigern hebt den Nutzen. Während der Kampagne operiert das Blue Team meist ohne Vorwarnung. Reagiert es schnell und angemessen, sinkt die Verweildauer der Angreifer im Netzwerk. Misslingt die Erkennung, zeigt sich, dass bestimmte Angriffe und Sicherheitslücken noch nicht ausreichend adressiert sind.
Viele Unternehmen etablieren deshalb ein Purple-Team-Format. Dieses vereint Mitglieder beider Seiten und fördert Wissenstransfer in Echtzeit. Der red-Anteil demonstriert eine Technik, der blue-Anteil baut sofort eine Erkennungsregel, danach prüft das Red-Team die Wirksamkeit. Durch dieses gemeinsame Teaming werden Fähigkeitslücken schneller geschlossen, Ressourcen effizienter genutzt und Security-Strategien an aktuelle Angriffsvektoren angepasst. Die gesamtheitliche Perspektive verbessert die Sicherheitslage spürbar und verringert das Risiko schwerer Sicherheitsvorfälle. Regelmäßige gemeinsame Workshops, Tabletop-Szenarien und automatisierte Lab-Umgebungen vertiefen den Austausch noch weiter.
Kennzahlen wie Mean Time to Detect oder False-Positive-Rate werden transparent geteilt und dienen als Ansporn, Abläufe zu optimieren. Gleichzeitig gewinnen Führungskräfte einen klaren Überblick, welche Investitionen in Infrastruktur, Schulung und Personal messbaren Mehrwert liefern für das gesamte Unternehmen.